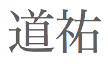Der Frühlingsanfang scheint hier im Nordosten der Schweiz für ein paar Tage ins Stocken geraten zu sein. Nebel und niedrige Temperaturen sorgen für eine kühle Atmosphäre, fast so als befände man sich in einem riesigen Kühlschrank. Die Menschen hier in Waldstatt plaudern über das Wetter, wie überall sonst auch, und man versucht mir zu versichern, dass nächste Woche schönes Wetter kommen wird. Aber ich habe kein Problem mit den kühlen, feuchten Tagen. Die Energie ist sehr gut für Meditation und Kontemplation.
Viele Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich einige Jahre als Mönch in zen-buddhistischen Tempeln verbracht habe. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist: „Warum bist du gegangen?“ Ehrlich gesagt war ich früher etwas beleidigt wegen dieser Frage. Ich hatte meine Zweifel, ob die Menschen, die mich da zu einem sehr schwierigen Übergang in meinem Leben befragten, verstanden hatten, warum ich mich überhaupt entschieden hatte, als Mönch zu leben, und warum ich so lange im Kloster geblieben war. Wir sprachen hier über meine ganz persönliche Beziehung zu Buddha, Dharma und Sangha, und nicht über das Wetter. Vielleicht fühlte es sich so ähnlich an, als würde mich ein Fremder über eine frühere Ehe ausfragen und wissen wollen, warum ich mich von einer Frau, die ich sehr geliebt hatte, scheiden ließ.

Ich verstehe jetzt besser, warum die Menschen so schnell auf das Ende meiner Klostergeschichte anspringen. Es ist nicht leicht, geduldig zu sein, wenn es darum geht, unser herausforderndes Leben zu verstehen, oder das eines anderen Menschen. Viele von uns haben einen Mönch oder eine Nonne in sich, die gerne einen guten Teil ihres Lebens an einem abgelegenen Ort verbringen würde, um in sich zu gehen, unterstützt von gleichgesinnten Menschen. Wir wollen andererseits diese Idee aber auch loslassen und uns voll und ganz auf unser Leben einlassen, da wo wir gerade in der Welt stehen. Für die meisten Menschen ist es auch besser, diese Idee loszulassen und sich voll und ganz auf das Leben einzulassen, genau dort, wo auch immer wir uns in der Welt befinden.
Für mich war das Leben im Tempel keine Erfahrung, die ich einfach abhaken und sagen konnte: „Das war interessant, was kommt jetzt?“ Es war ein unglaublich herausforderndes Kapitel meines Lebens, in dem ich kraftvolle Beziehungen zu Orten und Menschen aufbaute, die sich im Laufe der Zeit vertieften und mein Wesen zutiefst prägten.
Ein großer Teil meiner Ordination bestand darin, die zen-buddhistische Gemeinschaft als meine Familie anzunehmen. Es war ein echter Akt des „Zuhause verlassens“, und dieses Ritual hatte große emotionale, psychologische und energetische Auswirkungen.
Das Zuhause verlassen...was bedeutet das wirklich? 1985 wollte ich auf jeden Fall weg von dem Materialismus und der tief verwurzelten kollektiven und individuellen Selbstbezogenheit, die in den USA, wie ich sie kannte, herrschten. Ich hatte 1983-1984 Geschichte in Europa studiert und in einem Land gelebt, durch dessen Mitte eine Mauer verlief. In dieser Zeit habe ich mit einer gewissen Sympathie für den Marxismus viele osteuropäische Länder besucht. Was ich bei diesen Besuchen sah, waren Armut, Umweltverschmutzung und Schusswaffen. Ich war diesen Dingen nie ausgesetzt gewesen, und meine Begeisterung für den Sozialismus/Kommunismus schwächte sich deutlich ab. An der Universität in Göttingen wurde ich ständig von Studenten aufgefordert, die amerikanische Perspektive zu den Themen der Zeit zu erklären: den Philippinen, Nicaragua, El Salvador, der Stationierung von Atomraketen in Westdeutschland und mehr. Es gab viele wichtige Themen, und ich war in jenen Tagen keineswegs ein Meister der Debatte, noch weniger auf Deutsch.
Als ich in die USA zurückkehrte, wurde Ronald Reagan mit einem überwältigenden Sieg wiedergewählt. Ich hatte den Eindruck, dass die amerikanische Öffentlichkeit so gut wie kein Interesse an einer kritischen Diskussion zu den großen internationalen Fragen zeigte. Die simple Rhetorik des Kalten Krieges reichte fast allen in meinem Umfeld. Doch die Oberflächlichkeit des Mainstream-Denkens über soziale Fragen in meiner Generation war frustrierend. Es gab so viel Leid da draußen, und ein beträchtlicher Teil davon war das Ergebnis von Entscheidungen, die von Amerikanern wie mir getroffen wurden. Und es gab so viel zu tun, um zu reifen, um an mir selbst zu arbeiten, damit ich mich in einer sehr komplizierten Welt nützlich fühlen konnte. Oder war ich dabei, verrückt zu werden? Auf jeden Fall fühlte ich mich zu Hause wie ein Alien.
Entfremdet, aber immer noch hoffnungsvoll, gelang es mir, nach meinem Abschluss ein One-Way-Ticket nach Japan zu bekommen. Mein Plan war es, intensiv in die asiatischen Lebenswelten einzutauchen. Noch als Teenager war ich einem indischen Weisen, J. Krishnamurti, begegnet und hatte in einem Universitätskurs einen buddhistischen Mönch aus Sri Lanka kennengelernt. Ich hatte viele spirituelle Bücher gelesen. Ich lernte Zen kennen und begann selbst zu meditieren, in der Hoffnung, meine neurotischen Gedanken loszuwerden und das Herz des selbstlosen Dienens zu entdecken. Diese Einflüsse kamen aus dem Osten. Nachdem ich den Glauben an eine gesunde sozialistische oder kommunistische Entwicklung zu Hause oder in Europa verloren hatte, fragte ich mich, ob es nicht doch gesündere Gesellschaften als die mir bekannten gäbe. Ich könnte in Japan Englisch unterrichten, um Geld zu verdienen, und schließlich ganz Asien sehen. Das war meine Hoffnung.
In meinem zweiten Jahr in Japan reiste ich hinunter nach Hiroshima. Auf dem Weg dorthin kam ich zufällig an einem Tempel in Okayama vorbei. Ich holte meine Bambusflöte heraus, um ein paar Töne zu spielen, und sah einen älteren Priester mit einer Yodo-ähnlichen Aura spazieren gehen. Sein Hund kam zu mir und begrüßte mich. Es kam zu einem Gespräch. Er erzählte mir, dass Ausländer dort im Tempel Zen-Training machten. Mein Japanisch war zu diesem Zeitpunkt nicht sehr gut, aber es wurde mir etwas sehr Wichtiges mitgeteilt. Eine Tür wurde geöffnet.

Nachdem ich in Aikido und dem Spiel auf der Shakuhachi (Bambusflöte) eingeweiht worden war und ein paar Jahre lang durch Japan gereist war, hatte ich genug vom modernen Japan gesehen. Fast alle Menschen dort gaben sich mit dem materiell geprägten Leben zufrieden, das ich bereits als Jugendlicher in Südkalifornien erlebt hatte. Ich sehnte mich danach, die Tiefen der fernöstlichen Seele zu berühren, und konnte mich daher nicht mehr dazu motivieren, Erwachsene und Kinder, die süchtig nach Videospielen, Dosenkaffee und Mangas waren, Englisch beizubringen.
Ich erinnerte mich an den Tempel, wo ich dem beeindruckenden alten Mönch begegnet war, dort wo Ausländer sich in Zen-Buddhismus übten. Ich hatte damals nur einen kurzen Besuch gemacht. Mein nächster Besuch war länger. Ein halbes Jahr später zog ich in den Sogen-ji-Tempel ein.
Ich kann nicht sagen, dass ich bewusst nach diesem Tempel gesucht habe, oder dass ich Mönch werden wollte. Diese Dinge geschahen, nachdem meine vagen Absichten zu einer Hingabe, einem Gelübde, herangereift waren und ich bereit war, einen guten Teil der mir zugeteilten Lebensenergie dem Zen-Meister, den Lehren des Buddha und der Zen-Gemeinschaft zu widmen. Diese Entscheidung bedeutete ein abruptes Ende der Abhängigkeit von materieller oder emotionaler Unterstützung durch „zu Hause“.
Ich versuche, meine Hoffnungen und Erfahrungen im Tempel in Form eines Buches, vielleicht eines Romans, niederzuschreiben. Bilder und Beschreibungen können das, was sich in mir verändert hat, besser vermitteln als Erklärungen. Etwas hatte sein Zuhause verlassen. Etwas konnte auf eine Art und Weise beobachten und durchhalten, wie ich es vorher nicht konnte. Aber für den Verstand, der eine perfekte Welt wollte, oder selbst noch perfekter zu werden glaubte, gab es nur „Große Anstrengungen, keine Ergebnisse“. Kennst du das?
Ich habe wenig natürliches Talent für alles Meditative. Ein guter Meditierender zu sein, erwies sich jedoch gar nicht als das Wesentliche der Ausbildung. Der Zen-Meister half mir, gesunde Wurzeln in meinem Wesen zu schlagen, damit ein Baum mit anständigen Früchten eine Chance hatte zu wachsen. Der Meister gab mir den Namen DoYu, ‚der Weg der Fülle‘.
Das ist also ein Teil der Gründe, warum ich in den Tempel ging und warum ich fünfzehn Jahre dort blieb.
Und warum bin ich denn dann gegangen?
Ja, ich ging wieder weg von einem Zuhause, und das war nicht leicht!
Offensichtlich hatte ich damals, als ich fortging, genug Zuversicht und Energie, um den Schritt aus der Welt des Tempels heraus zu tun und trotzdem mein Streben fortzusetzen, nützlich und zufrieden mit meiner Aufgabe in dieser Welt zu leben. Nach so langer Zeit im Tempel war die Welt außerhalb des Klosters für mich nicht einfach. Aber viele Jahre später, in der Kälte und dem Nebel meines Dorfes hier in der Schweiz, reift mein Baum weiter. Und gutes Wetter kommt!